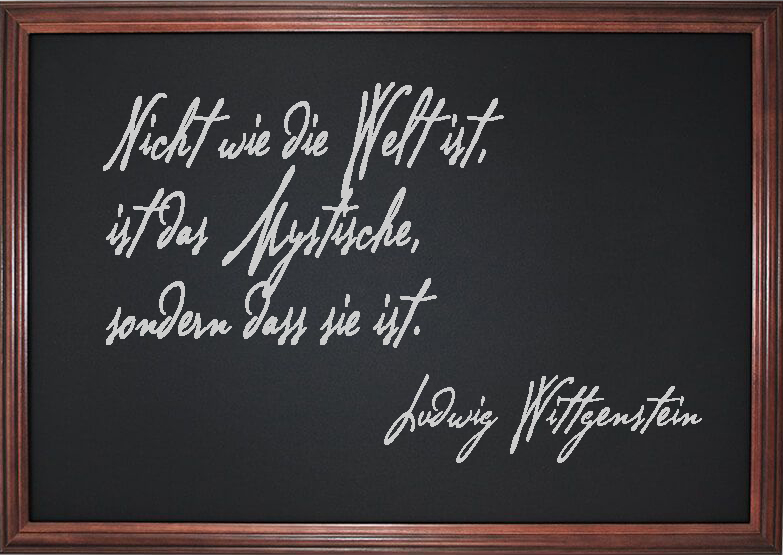Nummer 11:
Zwischendurch mal etwas Heiteres: «Der junge Herr ist ein vortrefflicher Nichtsnutz und ein äußerst rares Stück an Taugenichtstum, drum will ich ihm feierlich die Hand meiner Tochter zum Sankt-Nimmerleins-Tag versprechen, so wahr ich ihm bis selbigem Tag verwehre, die Schwelle meines Hauses zu betreten!», barock für Neudeutsch: «Verpiss dich!» — Was uns hier aber interessiert, ist der Sankt-Nimmerleins-Tag, den auch Bertolt Brecht in ‹Der gute Mensch von Sezuan› würdigt. Im Mittelalter bis ins frühe 19. Jahrhundert hinein war es üblich, auch in offiziellen Dokumenten, statt eines Datums, den Tag anzugeben, an dem ein bestimmter Heiliger oder eine bestimmte Heilige gefeiert wurden: Zu Martini hieß am 11. November, zu Luciae am 13. Dezember, zu Sancti Petri et Pauli am 29. Juni und zu Stephani, das wissen wir noch heute, bedeutete seit jeher am 26. Dezember. — Der Sankt Nimmerlein kommt im Kalender jedoch nicht vor, also heißt ‹zu Sankt Nimmerlein› schlicht und ergreifend ‹nie›! — Ähnliches hatte sich schon Kaiser Augustus ausgedacht, als er sagte, seine Schuldner würden ihre Schuld wohl ‹ad kalendas graecas soluturos› (zu den griechischen Kalendae begleichen). Die Kalendae sind jeweils der erste Tag eines Monats des römischen Kalenders. Allein im griechischen Kalender gab es keine Kalendae. — Es gibt ähnliche Wendungen: ‹Wenn der Hahn ein Ei legt…›, ‹Wenn Ostern und Weihnachten auf denselben Tag fallen…› etc., aber die schönste finde ich — man sehe mir den Chauvinismus nach — die neapolitanische Wendung: ‹Tu parle quanne pisc a gallin› (Du kannst reden, wenn das Huhn pisst!) — Ach, wie gern würd’ ich dies den vereinigten Populistinnen und Populisten dieser Welt sagen dürfen!
Nummer 12:
Schlimm ist es nicht, wenn man meint, Polenta bedeute Mais. So steht es schließlich auf der Packung im Warenhaus angeschrieben (anstelle von ‹Maisgrieß›). Schlimm nicht, nur falsch. Ich habe auch schon mal einen Bauern gehört, der auf seinen Acker zeigte und sagte, da habe er Polenta angebaut. Ich schaffte es gerade noch, nicht herauszuprusten, zeigte auf eine Kuh auf der Weide und sagte: «Wie ich vermute, haben Sie auf diesem Feld Käse und vielleicht etwas Jogurt angebaut.»
Das Wort ‹polenta› KOMMT nicht aus dem Lateinischen, es IST lateinisch! Genauso! Unverändert in Schreibweise, in Aussprache, in kulinarischer Funktion und in seinem Herstellungsverfahren. Ziemlich sicher ist ‹polenta› als weit verbreitete und in allen Gesellschaftsschichten beliebte Spezialität aus dem allgemeineren ‹puls, pultis› (Brei) entstanden. (Das moderne italienische Wort ‹poltiglia› ist daraus abgeleitet, ist aber immer negativ konnotiert und bezeichnet ausschließlich einen unappetitlichen, ungenießbaren Brei — mehr oder weniger: einen Schlangenfraß.)
Polenta war im Römischen Reich neben Brot Hauptnahrung für Kaiser und Legionär, für die Ancilla, die Sklavin und die Wahrsagerin. Man hat in Pompeji Fresken ausgegraben, die — wie in einem heutigen Comic — Schritt für Schritt zeigen, wie man eine gute Polenta macht. Im Mittelalter verbreitete sich dann die Speise (freilich in lokalen Variationen) im ganzen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, durch die Republik Genua zu den Anrainern des Schwarzen Meeres und durch die Republik Venedig in Dalmatien, Griechenland, Zypern bis in den Nahen Osten (wo das Gericht zwar durch die Venezianer in Mode kam, allerdings bereits zuvor als autochtone Erfindung nicht ganz unbekannt war).
Ich weiß schon, was jetzt einige einwenden möchten: Mais kommt erst nach der Invasion, Plünderung und Unterwerfung Amerikas durch die Europäer auf unsere Tische. — So ist es. Doch genau da ist der springende Punkt. Bis zum späten 17. Jahrhundert (Johann Sebastian Bach wurde 1685 geboren) wäre niemandem in den Sinn gekommen, Polenta aus Mais kochen zu wollen. Und auch als man mit Mais (auf Italienisch ‹granoturco›) zu experimentieren begann, blieb diese exotische Variante lange teuer, folglich den Adeligen und den reichen Kaufleuten vorbehalten.
Woraus machte man also dann Polenta? — Aus allen erdenklichen Getreidearten: aus Weizen, Hirse, Roggen, Dinkel. Und die Polenta, die ich am liebsten habe und die über Jahrhunderte in der Toskana, in der Valtellina, in der Val Poschiavo Generation um Generation ernährt hat, ist die Polenta aus Kastanienmehl!
Nebenbei: Der Hirsebrei, den Hedwig Tell für ihren Wilhelm, für Walterli und Willi kochte, war nichts anderes als Polenta, und vielleicht hatte sie das Wort sogar schon mal gehört — beim Pfarrer, bei einem Mönch, bei einem italienischen Bankier oder Tuchhändler in Luzern oder bei sonst jemandem, der Latein oder Italienisch konnte.
Nummer 13:
Immer sehr vergnüglich ist das Aufdecken sogenannter Volksetymologien. Eine Volksetymologie (auch ‹Paretymologie› oder ‹Eindeutung› genannt) ist eine historisch falsche Wortentwicklung, der eine naive Missdeutung eines Wortes (meistens aus einem anderen Sprachraum) zugrunde liegt.
Einige Beispiele:
Eine Hängematte hat weder mit hängen noch mit einer Matte etwas zu tun! Das Wort ist aus dem Spanischen ‹hamaca› übernommen und eingedeutscht worden und stammt ursprünglich aus der inzwischen ausgestorbenen Sprache der haitischen Eingeborenen: ‹hamak› = Bett.
‹Chou›, Französisch für Kohl, und ‹croute› (Kruste) gibt das Wort ‹choucroute› = Krustenkohl. In der bekannten besonderen Verarbeitung deuteten Deutschsprachige aber ‹chou› als ‹sauer› und ‹croute› als ‹Kraut›, eben als ‹Sauerkraut›.
(Zu diesem Eintrag gibt es auch gegenteilige Theorien, die sogar noch fundierter zu sein scheinen als diese. Ein Mangel der neueren Deutungen ist, dass sie die Existenz des Wortes ‹Krustenkohl› nicht erklären, sondern überhaupt ignorieren. Unabhängig davon, ob die hier vorgestellte oder die auf der entsprechenden französischsprachigen Wikipedia-Seite publizierte Interpretation die richtige ist, handelt es sich in beiden Fällen um eine Volksetymologie; hier um eine deutsche, andernfalls um eine französische. [Mit Dank an Elisha Schneider für den Hinweis.])
Eine in Nordeuropa und Nordasien lebende Marder-Art nennen die Norweger ‹fjeldfross› (Felsenkatze). Das klang für Deutschsprachige wie ‹Vielfraß›.
‹Guten Rutsch!› wünschen wir jeweils Ende Dezember. Man hat da wohl die Assoziation an die vereisten Straßen zu der Jahreszeit und wünscht, dass man darauf ins neue Jahr rutschen möge, ohne auszurutschen. Nun hat dieser ‹Rutsch› aber nichts mit dem ‹Rutschen› zu tun. Unsere jüdischen Mitbürger sagten auf Hebräisch zueinander ‹Rosch ha-Schana› (רֹאֹשׁ הַשָּׁנָה), was bloß ‹Anfang oder eigentlich Kopf des Jahres› bedeutet.
Ebenfalls unseren lieben jüdischen Mitbürgern haben wir ‹hatsloche un broche› (הצלחה ון ברכה = ‹Erfolg und Segen›) zu verdanken, aus dem wir dann ‹Hals- und Beinbruch› gemacht haben.
Im ungarischen Heer sahen die Berittenen natürlich auf die Soldaten zu Fuß herab. Die rangtieferen Infanteristen hießen ‹tolpas›; ausgesprochen ‹Tollpasch›, (‹s› wird im Ungarischen immer ‹sch› ausgesprochen; um ‹s› auszusprechen, muss man im Ungarischen ‹sz› schreiben, wie in ‹Liszt›). Im deutschsprachigen Teil der Doppelmonarchie glaubte man beim ungarischen Soldaten Tollheit und patschige Ungeschicklichkeit zu hören und hat aus ihm den Tollpatsch gemacht.
Es gäbe noch unzählige Beispiele. Aber ich will euch nicht langweilen. Ein letztes vielleicht noch: Die berühmten Leghorn-Hühner haben keine Hörner und legen nicht besonders viel — sie wurden bloß im toskanischen Livorno gezüchtet.
Nummer 14:
Um es gleich klarzustellen: «Relata refero!» (Ich überbringe bloß Nachrichten, die mir überbracht worden sind!) Erstens kann ich mit diesem klassischen Zitat ein bisschen prahlen, protzen und meine Eitelkeit befriedigen, zweitens kann ich zeigen, wie unglaublich dicht und konzis Latein gegenüber modernen Sprachen ist, und drittens möchte ich einer ungerechten Verurteilung vorbeugen: Was zu beschreiben ich mich anschicke, finde ich nämlich selbst nicht schön! Mein persönlicher Einfluss auf die Sprachentwicklung der vergangenen tausend Jahre war halt äußerst gering, sozusagen zu vernachlässigen, und somit kann ich wirklich nichts dafür, dass manches so herausgekommen ist, wie es sich eben ergeben hat! ‹Es ist, wie es ist›, würde Erich Fried sagen, und ‹Lavabo in innocentia manus meas (ich wasche meine Hände in Unschuld)›, der bekannte römische Statthalter in Judäa.
‹Mulatte›, ‹Mestize›, ‹Maul(esel)›, ‹Maul(tier)› gehen auf dasselbe Wort zurück! (Tröstlicherweise der niedliche ‹Maulwurf› nicht; der geht bloß auf einen Irrtum zurück!)
Bringen wir es hinter uns: Als ‹Mulatten› und ‹Mestizen› bezeichneten die spanischen und portugiesischen Conquistadores — schändliche paläofaschistische Machos! — die Kinder, die sie mit indigenen Frauen zeugten und nicht als ihre Kinder anerkannten (zum Beispiel bezüglich Erbrecht oder Namensgebung). Später und auch in anderen Sprachen wurden diese Wörter verwendet, um generell Menschen zu bezeichnen, die einen Vater und eine Mutter verschiedener Ethnie hatten, besonders dann, wenn ein Elternteil hellhäutig und ein Elternteil dunkelhäutig war. — ‹Maultier› ist die Kreuzung zwischen Eselhengst und Pferdestute, ‹Maulesel› die Kreuzung zwischen Pferdehengst und Eselstute. Die Unterscheidung nach dem Geschlecht der Eltern machte man erst im Verlauf des Hochmittelalters. Im Vulgärlatein Süditaliens und bald ganz Europas waren beide Hybride schlicht ‹muli›. — Alle diese Wörter gehen aber auf Arabisch ‹ﺎﻞمولّد› (almuwallad) zurück, was ‹Bastard› bedeutete, ein Bub (für Mädchen wurde der Begriff nicht verwendet), der einen arabischen Vater und eine nicht arabische Mutter hatte. (Ein Kind mit nicht arabischem Vater und arabischer Mutter konnte es wohl nicht geben, weil die Mutter ziemlich sicher schon vor der Niederkunft gesteinigt worden wäre.)
Weniger hässlich ist die Sache mit dem Maulwurf! Der erste Teil seines althochdeutschen Namens ‹muwerf›, also ‹mu›, meint nicht das Maul, sondern ein Häufchen, ein Erdhügelchen. Der zweite Teil, ‹werfan›, bedeutete nicht bloß im heutigen Sinn ‹werfen›, sondern auch ‹schieben, herausdrücken, hervorbringen›; man denke an ‹werfen› für ‹gebären› (bei Tieren) und an die geologischen ‹Verwerfungen›. — Wenn das putzige Tierchen schon fast blind ist, muss es wenigstens nicht auch noch das Maul halten.
Nummer 15:
Etwas, was in der Linguistik noch erquickender ist als die Etymologie, sind die Lautverschiebungen. Da gibt es ziemlich strenge Gesetzmäßigkeiten, die herbeigezogen werden können, um Etymologien und andere Sprachentwicklung zu erklären und zu beweisen. Sie erlauben den Sprachforscherinnen und Sprachforschern sogar, ausgestorbene Sprachen zu rekonstruieren. Über die spannendsten Lautverschiebungsgesetze werde ich auch ab und zu etwas posten, aber heute will ich über ein kurioses Phänomen schreiben, das in der Sprachentwicklung zwar häufig vorkommt, aber keiner echten Gesetzmäßigkeit folgt: die Metathese oder Metathesis. Das schwierig klingende griechische Wort (μετάθεσις) soll nicht abschrecken: es bedeutet bloß ‹Umstellung›, und hier ist damit gemeint: die Umstellung der Reihenfolge der Buchstaben eines Wortes.
Es gibt schier unzählige Beispiele für dieses Phänomen, und ich finde fast alle sehr lustig. Hier möchte ich nur ein paar wenige auflisten und euch dazu ermuntern, später selbst welche zu suchen, denn das Endecken und das Finden ist schließlich — wie beim Pilze-Suchen — das, was wirklich Spaß macht.
Lateinisch ‹Crocodylus›, Deutsch ‹Krokodil›, Englisch ‹Crocodile› → Italienisch ‹coccodrillo›, Spanisch ‹cocodrilo› (das R rutscht hinter das D)!
Der Deutsche und Französische ‹Roland› wird im Italienischen zu ‹Orlando› und das französische ‹parfum› wird zum italienischen ‹profumo›.
Aus dem lateinischen ‹Forum Iulii› (Handelsort des Julius) ist die italienische Region ‹Friuli› geworden.
Der Formkäse ist in Italien ‹formaggio›, aber in Frankreich ‹fromage›.
‹Algerien›, ‹Algérie› mutiert auf Spanisch zu ‹Argelia›, so wie die Spanier aus der lateinischen Gefahr ‹periculum› ein ‹peligro› und aus einem Profil ein ‹perfil› machen.
Das Ross wurde bei den englischen Rittern zum ‹horse› und der Brunnen bei den Dichtern zum ‹Born›.
Ich glaube, das genügt! Aber ich möchte noch einen Tipp für euer hoffentlich erfolgreiches Suchen und Entdecken geben! Horcht auf die Kinder, denn sie sind die wahren Meister im Erfinden von hübschen Metathesen. — Mein jüngerer Sohn entwickelte, als er klein war, in dieser Disziplin eine besondere Kreativität: Aus ‹salame› machte er ‹samale›, aus ‹acqua› machte er ‹auca› und meinen Freund René nannte er Öner! Was mich an letzterem besonders freute, war, dass Öner türkisch klingt und dies Öner ganz und gar nicht freute. Wir alle ärgern ihn heute noch liebevoll, indem wir ihn immer noch Öner nennen. Nur mein jüngerer Sohn hat inzwischen aus Öner eine Metathesis gemacht und nennt ihn jetzt René.