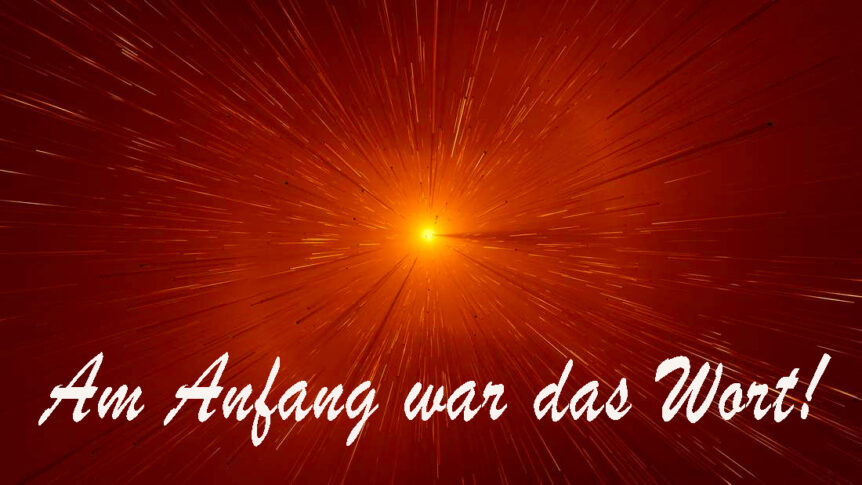Was hat das Zaunpfahl-Problem nun mit Pfingsten zu tun? — Das christliche Fest der ‹Ausgießung des Heiligen Geistes›, das am neunundvierzigsten Tag nach Ostern gefeiert wird, ist — wie Weihnachten und Ostern auch — die Aneignung und Umdeutung eines bereits bestehenden Festes. Ursprünglich war es ein jüdischer Feiertag, der sieben Wochen nach dem Passah-Fest gefeiert wurde: Es war ein Dankesfest, und die Israeliten pilgerten an diesem Tag zum Tempel in Jerusalem, wie sie es zum Passah-Fest und zum Laubhüttenfest taten. weiter lesen >
Vergils Sponsor
Es war also immer schon so. Unzählige Wörter und Sprachelemente, die sich im deutschsprachigen Raum inzwischen ganz heimisch und vollkommen assimiliert fühlen, haben Migrationshintergrund. Zurzeit kommen sie halt vermehrt aus dem angelsächsischen Raum — so what?
Merkwürdig ist jedoch, dass sehr oft Anglizismen, gegen die sich der Sprachpurismus wehrt, in Wirklichkeit gar keine sind. weiter lesen >
Der Ruf der Wölfin
Die Sprachwissenschaft muss sich in dieser Angelegenheit damit begnügen, ein paar wenige linguistische Fakten zu liefern, um vielleicht Historikerinnen und Historiker, Archäologinnen und Archäologen auf eine Spur zu lenken, die es allerdings wohl kaum ermöglichen wird, etwas anderes als bloße Hypothesen aufzustellen. weiter lesen >
Auferstehung zwischen Befreiung aus der Sklaverei und Feiern der Fruchtbarkeit
Das Wort ‹Ostern› geht auf ein germanisches Frühlings- und Fruchtbarkeitsfest zu Ehren der (schriftlich nicht belegten, aber sprachwissenschaftlich sehr plausiblen) Göttin der Morgenröte ‹Ostara› zurück. (Siehe dazu auch ‹Linguistische Amuse-Bouche›, Nr. 46 «Osternwestern», Seite 128.) weiter lesen >
Basel und die Fasnacht in der Fastenzeit
Laut einer Legende hätten die Basler während der Reformation, als sie den Bischof von Basel nach Solothurn verbannt hätten, auch die Fasnacht in die Fastenzeit gelegt, «um den Katholiken eins auszuwischen», wie es die Professorin Susanna Burghartz von der Universität Basel sarkastisch ausdrückt. weiter lesen >
Will you still be sending me a Valentine?
…wie eine Sandburg am Strand in der sengenden Sonne austrocknet, der Wind den trockenen Sand wegbläst, die Struktur immer mehr verwischt, bis schließlich eine größere Welle brandet und von der Burgruine nichts als eine vage Spur hinterlässt. Und diese vage Spur war die Frage: «Wer ist eigentlich dieser Valentin, dessen Tag man der Liebe geweiht hat?» weiter lesen >
Hoppe, hoppe, Reiter…
Das Bidet wird außer in Italien und in Portugal, wo es sowohl in Hotels als auch Privatwohnungen zur Standardeinrichtung der allermeisten Bäder gehört und seit 1975 sogar gesetzlich vorgeschrieben ist, im Rest Europas und der Welt kaum noch genutzt, falls es dort überhaupt je eine nennenswerte kulturelle Bedeutung gehabt hat. weiter lesen >
Begriff und Begreifen
Wer zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen ist, weiß, dass es in den verschiedenen Sprachen nicht für jedes Wort eine Entsprechung gibt und dass man gewisse Gedanken nicht bloß nicht übersetzen, sondern in einer andern Sprache nicht einmal denken kann. weiter lesen >
Sei kein Frosch!
Wenn man mit den Fröschen nicht vertraut ist, hat man starke Abneigung, sie zu berühren. Und dennoch ist irgendetwas an ihnen so stark anziehend, dass die Vorstellung entstanden ist, man könne, wenn man den Ekel überwinden würde, den richtigen Frosch sogar zu küssen, vielleicht sogar königlich belohnt werden. weiter lesen >
Anfang und Beginn
Was war der Anfang vom Anfang und der Beginn des Beginns? weiter lesen >